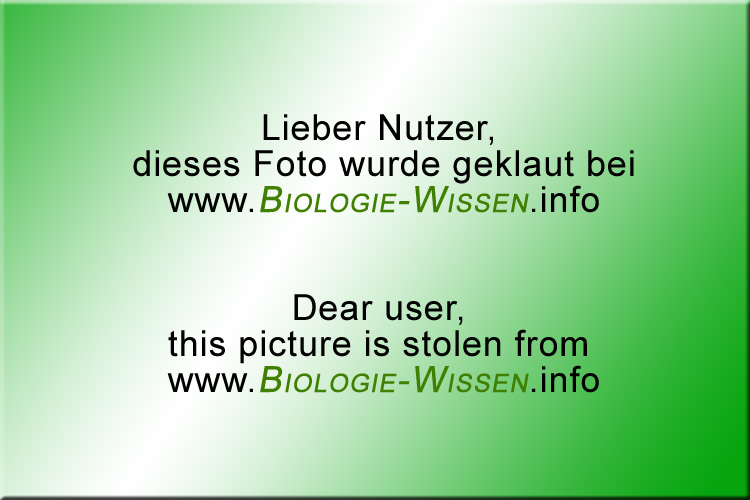1. Epithelien haben folgenden Ursprung:
[ ] a) ausschließlich ektodermal
[ ] b) ausschließlich entodermal
[ ] c) ausschließlich mesodermal
[x] d) alle Keimblätter
2. Darmepithelzellen bei Ascaris sind
[ ] a) einschichtiges Plattenepithel
[ ] b) Zylinderepithel mit Ciliensaum
[x] c) Zylinder epithel mit Mikorvillisaum
[ ] d) kubisches Epithel
3. Sehnen sind histologisch
[x] a) faserreiches Bindegewebe
[ ] b) zellreiches BG
[ ] c) grundsubstanzreiches BG
[x] d) ungeformtes BG
4. Monozyten besitzen
[ ] a) keinen Zellkern
[ ] b) einen gelappten Zellkern
[x] c) einen bohnenförmigen Zellkern
[ ] d) einen runden Zellkern
5. Quergestreifte Muskulatur kommt vor bei
[ ] a) Cnidaria
[x] b) Insekta
[ ] c) Annelida
[x] d) Vertebrata
6. Die Schilddrüse ist
[ ] eine exokrine Drüse
[x] eine endokrine Drüse
[x] zusammengesetzt alveolär
[ ] zusammengesetzt tubulär
7. Quergestreifte Muskelzellen
[ ] a) besitzen einen peripher liegenden Zellkern
[x] b) sind Plasmodien
[x] c) sind Syncytien
[x] d) besitzen viele Zellkerne
8. Sekundäre Sinneszellen sind
[ ] a) Sinnesnervenzellen
[x] b) Epithelzellen
[ ] c) Nervenzellen
[ ] d) Sinnesepithelzellen
9. Foraminifora haben einen
[x] a) heterophasischen Generationswechsel
[ ] b) diplo-homophasischen Generationswechsel
[ ] c) haplo-homophasischen generationswechsel
[ ] d) sekundären Generationswechsel
10. Trypanosoma gehört zu den
[ ] a) Apicomplexa
[x] b) Flagellata
[x] c) Kinetoplastida
[ ] d) Coccidia
11. Amoeba proteus hat
[x] a) eine kontraktile Vakuole
[ ] b) zwei kontraktile Vakuolen
[ ] c) ein Cytostom
[x] d) ein Uroid
12. Der Quadrulus befindet sich im
[ ] a) Peristom
[x] b) Vestibulum
[ ] c) Cytostom
[ ] d) Cytopharynx
13. Axopodien findet man bei den
[ ] a) Thecamoeba
[x] b) Radiolaria
[ ] c) Cytostom
[x] d) Heliozoa
14. Paramecium caudatum besitzt
[x] a) Pellicula
[x] b) Trichocysten
[ ] c) Protomerit
[ ] d) Uroid
15. Die Konjugation ist eine Form der
[ ] a) Gametogamie
[x] b) Gamontogamie
[ ] c) Autogamie
[ ] d) Pädogamie
16. Das Ektoplasma bei Amoeba proteus ist
[x] a) hyalin
[ ] b) granulär
[x] c) v. a. in den Lobopodien
[ ] d) v. a. im Uroid
17. Hydra sp. gehört zu den
[x] a) Hydroidea
[ ] b) Thecata
[x] c) Athecata
[ ] d) Trachylina
18. Das Polypenköpfchen heißt auch
[x] a) Hydranth
[ ] b) Probosis
[ ] c) Hydrocaulus
[ ] d) Hypostom
19. Die Gastrodermis bei Hydra sp. enthält
[x] a) Drüsenzellen
[ ] b) Interstitielle Zellen
[x] c) Nährzellen
[ ] d) Nematoblasten
20. Laomedea besitzt
[x] a) Hydrotheka
[x] b) Proboscis
[x] c) Leptomedusen
[ ] d) Anthomedusen
21. Die freilebenden Plathelminthes besitzen
[x] a) Rhabditen
[ ] b) sekundäre Leibeshöhle
[ ] c) geschlossenes Blutgefäßsystem
[ ] d) Sporocysten
22. Der Darm bei Dicrocoelium dendriticum ist
[ ] a) verzeigt
[ ] b) ein gerades Rohr
[ ] c) nicht vorhanden
[x] d) gegabelt
23. Die Larven der Cestoden sind
[x] a) Oncosphaeren
[ ] b) Redien
[ ] c) Miracidien
[x] d) Coracidien
24. Fasciola hepatica besitzt
[ ] a) Trochopora
[x] b) Sporocysten
[ ] c) Sporocysten II. Ordnung
[x] d) Metacercarien
25. Der Hautmuskelschlauch der Nematoda besteht aus
[ ] a) Ringmuskulatur
[x] b) Längsmuskulatur
[x] c) Hypodermis
[x] d) Cutikula |
26. Folgende Strukturen findet man bei Nematoda
[x] a) Rachis
[ ] b) Parenchym
[ ] c) Protonephridien
[x] d) Amphiden
27. Die Epidermis bei Ascaris ist ein
[ ] a)
Zylinderepithel mit Cutikula
[ ] b) Plattenepithel mit Cutikula
[x] c)
Syncytium mit Cutikula
[ ] d) Plasmodium mit Cutikula
28. Trichinen
[ ] a) haben keinen Wirtswechsel
[x] b) haben
einen Zwischenwirt
[ ] c) sind ovipar
[x] d) sind vivipar
29.
Mammalia gehören zur Gruppe der
[x] a) Amniota
[x] b) Craniota
[ ] c)
Anamnia
[ ] d) Phasmidia
30. Der ontogenetische Ursprung einer
adulten Rattenniere liegt im
[ ] a) Protonephros
[ ] b)
Mesonephros
[x] c) Opistonephros
[x] d) Metanephros
31. Im Laufe
der Entwicklung zum sekundären Kiefergelenk wurde das
[x] a) Hyomandibulare
zur Columella auris
[x] b) Hyomandibulare zum Stapes
[x] c) Quadratum zum
Incus
[x] d) Articulare zum Malleus
32. Die Ratte gehört zu den
[x] a) homöothermen Vertebraten
[ ] b) poikilothermen Vertebraten
[ ] c) monotremen
Vertebraten
[ ] d) marsupialen Vertebraten
33. Die Malpigischen Gefäße der Schabe sind
[ ] a) endodermales
Gewebe
[x] b) ectodermales Gewebe
[x] c) Organe der Exkretion
[x] d)
Organe der Osmoregulation
34. Insekten atmen über
[ ] a) Lungen
[x] b) Tracheen
[ ] c) Luftkiemen
[ ] d) den Mund
35. Die Thoraxextremitäten der Insekten bestehen aus folgenden Gliedern
[ ] a) Coxa, Trochanter, Femur, Patella, Tarsus, Praetarsus
[ ] b)
Coxa, Basis, Ischium, Mersus, Carpus, Propodus, Dactylus
[x] c) Coxa,
Trochanter, Femus, Tibia, Tarsus, Praetarsus
[ ] d) Coxa, Postcoxa, Femur,
Tibia, Tarsus, Praetarsus
36. Der Kopf der Schabe ist
[ ] a) vom prognaten Typ
[x] b) vom hypognaten Typ
[x] c) ectognath
[ ] d) entognath
37. Welche Blutfarbstoffe kommen in der Gruppe der Annelida vor
[x] a) Hämoglubin
[ ] b) Hämocyanin
[x] c) Hämoerythrin
[x] d) Chlorocruorin
38. Die Lateralherzen bei Lumbricus terrestris verbinden das
[ ] a) Bauchgefäß mit den Subneuralgefäß
[ ] b) Subneuralgefäß mit dem Rückengefäß
[x] c) Bauchgefäß mit dem Rückengefäß
[ ] d) Rückengefäß mit dem Lateronauralgefäß
39. Das Clitellum von Lumbricus sp. dient
[ ] a) der Speicherung von Glycogen
[x] b) der Mucopolysacharidbildung
[x] c) der Begattung
[x] d) der Kokonbildung
40. Folgende Annelidengruppen besitzen ein Clitellum
[ ] a) Polychaeta
[x] b) Oligochaeta
[x] c) Hirudinea
[x] d) Clitellata
41. Die Schale der Bivalvia besteht aus folgenden Schichten:
[ ] a) Corticum, Prismenschicht, Perlmutterschicht
[x] b) Peristracum, Prismenschicht, Perlmutterschicht
[ ] c) Periostracum, Corticum, Prismenschicht, Proteinschicht
[ ] d) Periostracum, Proteinschicht, Prismenschicht, Perlmutterschicht.
42. Folgende Sinnesorgane treten in der Gruppe der Mollusca auf
[x] a) Statocysten
[x] b) Osphradien
[ ] c) Trichobothrien
[ ] d) Tympanalorgan
43. Die Pericardhöhle der Mollusca stellt einen Teil
[ ] a) der primären Leibeshöhle dar.
[x] b) der sekundären Leibeshöhle dar.
[ ] c) des Mixocoels dar.
[ ] d) des Pseudocoels dar.
44. Mytilus edulis gehört zu den
[ ] a) Protobranchia
[ ] b) Septibranchia
[x] c) Filibranchia
[ ] d) Eulamellibranchia
45. Die Larve der Crustacea kann als
[ ] a) Veligerlarve bezeichnet werden.
[x] b) Zoealarve bezeichent werden.
[x] c) Naupliuslarve bezeichnet werden.
[ ] d) Trochophoralarve bezeichnet werden.
46. Bei Astacus sp. sind folgende Organe an der Exkretion und Osmoregulation beteiligt
[ ] a) Pecten
[x] b) Antennennephridien
[ ] c) Maxillarnephridien
[ ] d) Protonephridien
47. Astacus sp. besitzt folgende Extremitäten
[ ] a) zwei Paar Uropoden
[ ] b) vier Paar Pleopoden
[x] c) fünf Paar Paraeopoden
[ ] d) zwei Paar Maxillipeden
48. Das Herz von Astacus sp. pumpt Hämolymphe in
[x] a) sieben Arterien
[ ] b) sechs Arterien
[ ] c) fünf Arterien
[ ] d) vier Arterien |